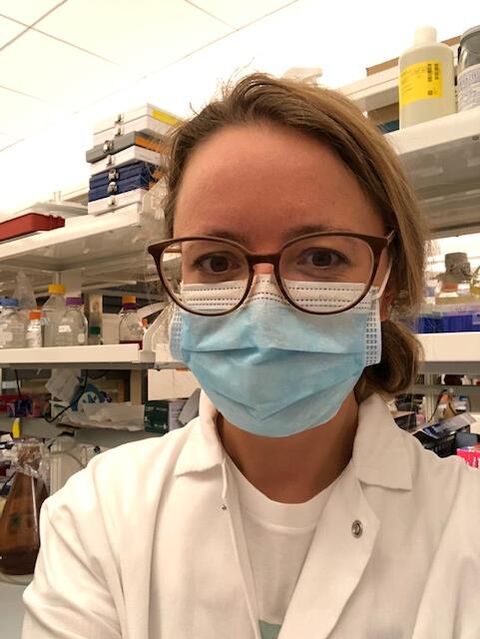2. Rehe und der Korezeptor
Der Forschungsalltag hat Stefanie Deinhardt-Emmer wieder. Sie hat sich an ihrem Arbeitsplatz im Buck-Institut eingerichtet, die Arbeitsgruppe kennengelernt und gleich die ersten Projekte in Angriff genommen. „Meist bin ich morgens die erste im Labor, dann ist es noch ganz ruhig hier draußen, das Institut liegt ja etwas vor der Stadt.“ Die Labore und Büros im Institut sind derzeit nicht komplett ausgelastet, weil einige Gastwissenschaftler nicht anreisen konnten, andere nur tageweise hier sind und sonst im Homeoffice arbeiten.
Langer Atem für Vorbereitung und Mitteleinwerbung
Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen an das Buck-Institut, um die biomedizinischen Mechanismen des Alterns zu erforschen. Mit ihren Forschungsideen bewerben sie sich als „Visitor Scientist“ um die zeitweise Aufnahme in einer der 22 Arbeitsgruppen. Die Reise- und Lebenshaltungskosten müssen sie aus eigenen Mitteln oder selbst eingeworbenen Stipendien bestreiten. Ihren Aufenthalt in Kalifornien bereitete Stefanie Deinhardt-Emmer etwa zwei Jahre lang vor. „Ich wollte unbedingt in das Labor von Judy Campisi, die den Zusammenhang von Altern und Infektion untersucht.“
Besonders interessierte sich die Jenaer Mikrobiologin für die physiologischen Prozesse in Lungenbläschen, wie diese bei einer Infektion durch Viren und Bakterien gestört werden und warum ältere Menschen für solche Superinfektion besonders anfällig sind. Ihr Vorschlag wurde von einer Jury aus Fachwissenschaftlern begutachtet und für die Förderung im sogenannten Advanced Clinician Scientist Programm der Medizinischen Fakultät Jena ausgewählt. Das Programm fördert junge Ärztinnen und Ärzte, die eigene Forschungsthemen bearbeiten möchten und dafür eine Auszeit von der Tätigkeit in der Krankenversorgung erhalten. Neben dieser Finanzierung hat sich Stefanie Deinhardt-Emmer auch erfolgreich um ein Novartis-Graduiertenstipendium beworben. Dass ihre Familie mitgekommen ist in die USA, ist - auch finanziell – Privatvergnügen.
Das Buck Institute
Nach der Bewältigung vieler bürokratischer Hürden, die durch Covid-19 noch einmal höher wurden, ist Stefanie Deinhardt-Emmer nun also Gastwissenschaftlerin am Buck Institutewww.buckinstitute.org . Das vor gut 20 Jahren gegründete Institut war eine der ersten biomedizinischen Institutionen, die sich schwerpunktmäßig der Erforschung des Alterns und der altersbedingten Krankheiten widmeten. Es wird von einer privaten Stiftung finanziert und arbeitet mit der University of California zusammen. In Novato, nördlich von San Francisco, thront der futuristische Gebäudekomplex des Instituts am Fuße eines Berges über dem Highway.
„Das Gebäude ist mega-modern, mit großzügigen Foyers und viel Glas. Auf dem riesigen Gelände fühlen sich auch jede Menge Tiere wohl, es gibt wilde Truthühner, Schlangen, Salamander und vor dem Laborfenster stehen auch mal Rehe“, so Deinhardt-Emmer. Der Arbeitsplatz für den einzelnen Wissenschaftler ist eher pragmatisch bemessen - das „Büro“ besteht aus Schreibtisch und Regal, dazu kommt ein normaler Laborarbeitsplatz. „Aber jeder hier hat Zugriff auf die Core Units, deren Mitarbeiter eine riesige Expertise zum Beispiel für Massenspektrometrie oder Rasterelektronenmikroskopie haben.“ Diese Methodiker nehmen unmittelbar an den Lab-Meetings teil und sind so wichtige Partner für die Forscher in den Arbeitsgruppen. Beeindruckt war Stefanie Deinhardt-Emmer auch von den allerersten Tagen im Institut: „Die Abläufe klappen prima. Es hat keine Stunde gedauert, bis ich mit meinem Laptop komplett in das IT-Netz des Instituts eingeklinkt war.“ Zur Einweisung gehörte auch eine Antirassismus-Pflichtweiterbildung mit Lehrvideos und anschließenden Multiple-Choice-Test.
Die Dipeptidyltransferase 4
Im Lab-Meeting in der Campisi Group stellte Stefanie Deinhardt-Emmer ihr erstes Forschungsprojekt vor. Darin geht es um die Dipeptidyltransferase 4, kurz DDP4. Dieses Enzym ist ein Oberflächenprotein und kommt in vielen Zelltypen vor. DDP4, das konnten Wissenschaftler bereits vor einigen Jahren am Beispiel des MERS-Virus zeigen, wirkt als Korezeptor für Corona-Viren. jüngst wurde nachgewiesen, dass auch SARS-CoV-2 an dieses Protein binden kann. Es ist also beteiligt, wenn die Viren an die Zelle andocken und ihre Erbinformation einschleusen, um diese von der Zelle vervielfältigen zu lassen. Eine neuere Studie kommt zudem zu dem Ergebnis, dass dieser Corona-Korezeptor in älteren Zellen vermehrt hergestellt wird. „Das könnte einer der Mechanismen sein, die ältere Menschen anfälliger machen für virale Infektionen“, vermutet Stefanie Deinhardt-Emmer. Deswegen möchte sie nun den Zusammenhang zwischen Alterung und den schwereren Verläufen von COVID-19-Erkrankungen anhand des Korezeptors DPP4 analysieren.
In einer ersten Versuchsserie konnte sie dazu verschiedene Modelle für gealterte Zellen nutzen, also Zellkulturen, die typische Altersanzeichen aufweisen und die die Arbeitsgruppen am Buck-Institut für ihre Forschung nutzen. Stefanie Deinhardt-Emmer suchte nach DDP4 in den Zellen der Gefäßinnenseiten, in Bindegewebszellen, in den Stützzellen im Gehirn, in der Hornhaut im Auge und in bestimmten Gewebsstammzellen. Dabei führt sie die Pipette selbst, denn Laborassistenten gibt es am Institut nicht. Ihr Ergebnis: „In allen diesen Zelltypen wurde im Altersmodell mehr DDP4 produziert als in den jungen Zellen!“ Ein Ergebnis, dass es nun gleich zu Papier zu bringen gilt, damit die Wissenschaftscommunity es begutachten, wahrnehmen und weiterverwenden kann.
Publish or perish
Diesen erfolgreich durchlaufen hat jetzt ein anderer Artikel, an dem Stefanie Deinhardt-Emmer als Erstautorin mitgearbeitet hat (vorab als preprint https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.01.182550v1) . Darin berichten Ärzte und Naturwissenschaftler des Jenaer Uniklinikums von der Untersuchung von Patienten, die an COVID-19 verstorben sind. Die betrachteten elf Autopsien waren jeweils nur wenige Stunden nach den Tod durchgeführt und das Gewebe in verschiedenen Organen auf SARS-CoV-2, Entzündungsmarker und Gewebeschäden untersucht worden. Wie erwartet fanden die Wissenschaftler Virus-DNA vor allem in der Lunge, und dort war das Gewebe auch schwer betroffen. Bei einigen der Patienten gab es auch Viren in Verdauungsorganen, Nieren oder den Herzgefäßen, die Entzündungsmarker waren immer erhöht. „Aber nur in der Lunge hatte das Virus das Gewebe angegriffen. Das stützt die Vermutung, dass das eigentliche Problem bei COVID-19 eine unangemessene Immunantwort auf die Infektion ist“, so Stefanie Deinhardt-Emmer.
Und wenn die Gastwissenschaftlerin nicht im Labor arbeitet? Dann erkundet sie zum Beispiel mit ihrer Familie die beeindruckende Umgebung – wenn die Naturgewalten das zulassen. „Wir hatten mehr als 40 Grad im Schatten, das war schon krass. Auch haben uns die Waldbrände sehr getroffen, zwei Tage lang musste das Institut sogar schließen, weil die Lüftungsanlage der Asche in der Luft nicht gewachsen war. In der gesamten Umgebung lag diese Asche als Schicht auf allen Oberflächen und in San Francisco wurde es gar nicht richtig hell“, berichtet sie. Ihr Sohn Friedrich musste schmerzhaft erfahren, dass die einheimische Tierwelt auch unangenehme Seiten hat. Ihn hatte eine Bremse gestochen, das folgende Fieber und seine heftig geschwollene Hand sorgten für mütterliche Sorge – aber auch für mikrobiologisches Interesse. „Die Insekten hier können tatsächlich auch Hasenpest, die Tularämie, verbreiten. Glücklicherweise war es aber nur eine Reaktion auf den Biss und keine schlimme Infektion“, so die Ärztin.