Kontaktieren Sie uns gern unter:
E-Mail:
Telefon: 03641 – 9 32 35 93
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Studienteam
Jenaer Studienteam:
Valeska Kozik, Michelle Dreiling, Florian Rakers, Matthias Schwab (v.l.n.r.)

Funding: Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI)
Schwab M, Witte OW. Prenatal stress and brain disorders in later life. (2020). Neurosci Biobehav Rev. 2020 Jun 16:S0149-7634(20)30429-2. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.06.002.
Van den Bergh B.R.H., van den Heuvel MI., Lahti M., Braeken M., de Rooij S.R., Entringer S., Hoyer D., Roseboom T., Räikkönen K., King S., Schwab M. (2020). Prenatal developmental origins of behavior and mental health: The influence of maternal stress in pregnancy. Neurosci Biobehav Rev Jul 28. pii: S0149-7634(16)30734-5. [Epub ahead of print].
Franke K, Van den Bergh BRH, Rakers F, Kroegel N, de Rooij SR, Roseboom TJ, Witte OW, Nathanielsz, PW Schwab, M (2020). Effects of Malnutrition and Maternal Stress during Pregnancy on Offspring Brain Structure in Humans. Neurosci Biobehav Rev 2020 Jan 28:S0149-7634(17)30748-0. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.01.031.
Müller JJ, Antonow-Schlorke I, Kroegel N, Rupprecht S, Rakers F, Witte OW, Schwab M (2020). Cardiovascular effects of prenatal stress – Are there implications for cerebrovascular, cognitive and mental health outcome? Neurosci Biobehav Rev pii: S0149-7634(17)30308-1. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.05.024. [Epub ahead of print].
Rakers F, Rupprecht S, Dreiling M, Bergmeier C, Witte OW, Schwab M (2020). Transfer of maternal psychosocial stress to the fetus. Neurosci Biobehav Rev doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.02.019. [Epub ahead of print].
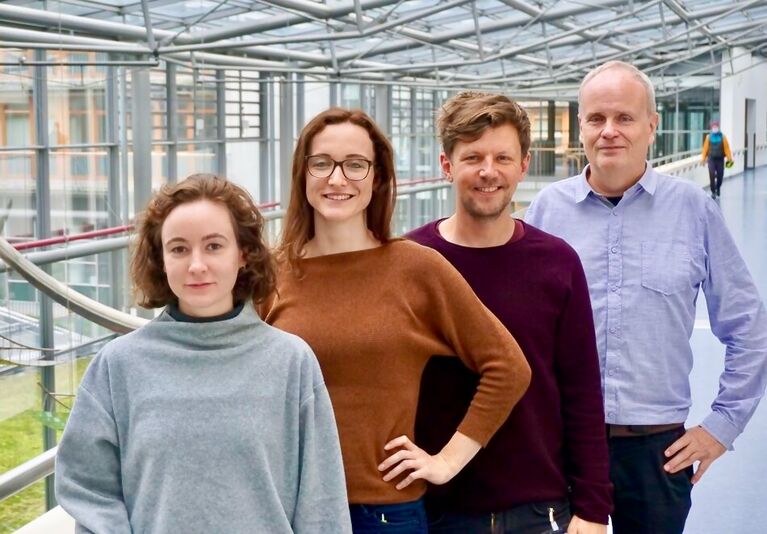

Bochumer Studienteam:
Prof. Dr. Kerstin Hellwig, Evelyn Adler, Sabrina Haben, Tanja Hesse-Sprawe, Rafael Antkowiak, Dr. Sandra Thiel, Theres Trabert, Melanie Dausel und Dr. Andrea I. Ciplea (v.l.n.r.)
Wissenschaftliche Studie zu Langzeiteffekten einer MS-Schubtherapie während der Schwangerschaft
Ungünstige Umwelteinflüsse während der Schwangerschaft können die Reifung und Entwicklung des ungeborenen Kindes stören und zu strukturellen und funktionellen Änderungen sämtlicher Organsysteme im späteren Leben führen. Insbesondere das Gehirn ist hiervon aufgrund der über die gesamte Schwangerschaft andauernden komplexen Reifungsschritte betroffen.
Umwelteinflüsse während der Schwangerschaft, welche die Entwicklung stören können, umfassen neben psychischem Stress oder Fehlernährung auch die Einnahme bestimmter Medikamente. Das Medikament „Kortison“ wird während der Schwangerschaft zur Behandlung von Schüben im Rahmen einer Multiplen Sklerose (MS) eingesetzt. Diese Behandlung gilt allgemeinhin als ungefährlich für das ungeborene Kind.
Es gibt neuere Untersuchungen, welche zeigen, dass erhöhte Konzentrationen von Glucocorticoiden (zu denen auch „Kortison“ gehört) während der Schwangerschaft langfristige Veränderungen der Entwicklung des ungeborenen Kindes verursachen können. Aufgrund des Wirkmechanismus im Körper kann Kortison insbesondere die Hirnentwicklung des heranwachsenden Kindes beeinflussen.
Um in Zukunft die Auswirkungen einer Kortison-Therapie während der Schwangerschaft für das ungeborene Kind besser abschätzen zu können, führt die Arbeitsgruppe Fetale Hirnentwicklung und Programmierung am Universitätsklinikum Jena in Thüringen nun eine wissenschaftliche Studie durch.
Unsere Studie wird durch den Grant for Multiple Sclerosis Innovation 2020 unterstützt.
Dafür werden Kinder und Jugendliche, deren Mütter an MS leiden hinsichtlich ihrer kognitiven und motorischen Entwicklung, etwaiger Verhaltensauffälligkeiten, sowie ihrer Stressempfindlichkeit untersucht.
Für diese Studie werden noch Probanden gesucht!
Wir suchen...
Schulkinder (8 – 18 Jahre), deren Mütter während der Schwangerschaft einen MS-Schub hatten und deswegen Kortison erhalten haben und Schulkinder (8 – 18 Jahre), deren Mütter an MS leiden jedoch kein Kortison während der Schwangerschaft erhalten haben.
Die Teilnahme an der Studie umfasst psychologische Tests (IQ-Test, Verhaltenstests / ADHS), die Bestimmung der Stressempfindlichkeit sowie eine kurze MRT-Untersuchung. Auf Wunsch können die Ergebnisse der Studie anschließend besprochen werden.
Probanden erhalten eine Aufwandsentschädigung von 150€ plus Fahrt- und ggf. Unterkunftskosten für eine Nacht.
Die Untersuchungen werden hauptsächlich in Jena (Thüringen) durchgeführt. Alternativ wurde ein zweites Studienzentrum in Bochum (Nordrhein-Westfalen) eingerichtet. Beide Studienzentren sind gut mit dem Auto oder der Bahn zu erreichen.
Die Studie wird unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen durchgeführt.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung zu dieser Studie schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
E-Mail:
Telefon: 03641 – 9 32 35 93
Wir freuen uns auf Sie!
Funding: Novartis
Funding: Novartis
Funding: Bayer Vital, Merck
Fischer M, Köhler W, Faiss JH, Hoffmann F, Kunkel A, Sailer M, Schwab M, Zettl UK, Bublak P; HIPPOCOMS Study Group (2019). A smart peek: Processing of rapid visual displays is disturbed in newly diagnosed, cognitively intact MS patients and refers to cognitive performance and disease progression in late stages. J Neurol Sci 401:118-124.
Köhler W, Fischer M, Bublak P, Faiss JH, Hoffmann F, Kunkel A, Sailer M, Schwab M, Stadler E, Zettl UK, Penner IK; HIPPOCOMS Study Group (2017). Information processing deficits as a driving force for memory impairment in MS: A cross--sectional study of memory functions and MRI in early and late stage MS. Mult Scler Relat Disord 18:119-127.
Kluckow SW, Rehbein JG, Schwab M, Witte OW, Bublak P (2016). What you get from what you see: Parametric assessment of visual processing capacity in multiple sclerosis and its relation to cognitive fatigue. Cortex 83:167-80.
Fischer M, Kunkel A, Bublak P, Faiss JH, Hoffmann F, Sailer M, Schwab M, Zettl UK, Köhler W. (2014). How reliable is the classification of cognitive impairment across different criteria in early and late stages of multiple sclerosis? J Neurol Sci 343(1-2):91-9.
Funding: Novartis
Rauer S, Hoshi M, Pul R, Wahl M, Schwab M, Haas J, Ellrichmann G, Krumbholz M, Tackenberg B, Saum K-U, Buck F, Leemhuis J, Kretschmann A, Aktas O (2020). Ocrelizumab Treatment in Patients with Primary Progressive Multiple Sclerosis: Results from a Compassionate Use Programme in Germany. Clin Neurol Neurosurg 197 106142.
Rieckmann P, Schwab M, Pöhlau D; Penner IK, Wagner T, Schel E, Bayas A (2019). Adherence to subcutaneous IFN β-1a in multiple sclerosis – final analysis of the non-interventional study READOUTsmart using the dosing log and readout function of RebiSmart®. Adv Therapy 36(1):175-86.
Schwab M (2011). Multiple Sklerose und Schwangerschaft. Der Gynäkologe 44:974–81.
Funding: Novartis
Schmidt P, Gaser C, Arsic M, Buck D, Förschler A, Berthele A, Hoshi M, Ilg R, Schmid VJ, Zimmer C, Hemmer B, Mühlau M (2012). An automated tool for detection of FLAIR-hyperintense white-matter lesions in Multiple Sclerosis. Neuroimage 59(4): 3774-83.
Franke K, Ziegler G, Klöppel S, Gaser C (2010). Estimating the age of healthy subjects from T1-weighted MRI scans using kernel methods: Exploring the influence of various parameters. Neuroimage 50(3): 883-892.
Hametner S, Endmayr V, Deistung A, Palmrich P, Prihoda M, Haimburger E, Menard C, Feng X, Haider T, Leisser M, Köck U, Kaider A, Höftberger R, Robinson S, Reichenbach JR, Lassmann H, Traxler H, Trattnig S, Grabner G (2018). The influence of brain iron and myelin on magnetic susceptibility and effective transverse relaxation - A biochemical and histological validation study. Neuroimage 179:117-133.
Deistung A, Schweser F, Reichenbach JR (2017). Overview of quantitative susceptibility mapping. NMR Biomed 30(4).
Schweser F, Deistung A, Reichenbach JR (2016). Foundations of MRI phase imaging and processing for Quantitative Susceptibility Mapping (QSM). Z Med Phys 26(1):6-34.
Langkammer C, Schweser F, Krebs N, Deistung A, Goessler W, Scheurer E, Sommer K, Reishofer G, Yen K, Fazekas F, Ropele S, Reichenbach JR (2012). Quantitative susceptibility mapping (QSM) as a means to measure brain iron? A post mortem validation study. Neuroimage 62(3):1593-9.
Stellmann JP, Krumbholz M, Friede T, Gahlen A, Borisow N, Fischer K, Hellwig K, Pache F, Ruprecht K, Havla J, Kümpfel T, Aktas O, Hartung HP, Ringelstein M, Geis C, Kleinschnitz C, Berthele A, Hemmer B, Angstwurm K, Young KL, Schuster S, Stangel M, Lauda F, Tumani H, Mayer C, Zeltner L, Ziemann U, Linker RA, Schwab M, Marziniak M, Then Bergh F, Hofstadt-van Oy U, Neuhaus O, Zettl U, Faiss J, Wildemann B, Paul F, Jarius S, Trebst C, Kleiter I; NEMOS (Neuromyelitis Optica Study Group) (2017). J Neurol Neurosurg Psychiatry 88(8):639-647.
Borisow N, Kleiter I, Gahlen A, Fischer K, Wernecke KD, Pache F, Ruprecht K, Havla J, Krumbholz M, Kümpfel T, Aktas O, Ringelstein M, Geis C, Kleinschnitz C, Berthele A, Hemmer B, Angstwurm K, Weissert R, Stellmann JP, Schuster S, Stangel M, Lauda F, Tumani H, Mayer C, Zeltner L, Ziemann U, Linker RA, Schwab M, Marziniak M, Then Bergh F, Hofstadt-van Oy U, Neuhaus O, Winkelmann A, Marouf W, Rückriem L, Faiss J, Wildemann B, Paul F, Jarius S, Trebst C, Hellwig K; NEMOS (Neuromyelitis Optica Study Group) (2017). Influence of female sex and fertile age on neuromyelitis optica spectrum disorders. Mult Scler 23(8):1092-1103.
Ayzenberg I, Schöllhammer J, Hoepner R, Hellwig K, Ringelstein M, Aktas O, Kümpfel T, Krumbholz M, Trebst C, Paul F, Pache F, Obermann M, Zeltner L, Schwab M, Berthele A, Jarius S, Kleiter I; Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS) (2016). Efficacy of glatiramer acetate in neuromyelitis optica spectrum disorder: a multicenter retrospective study. J Neurol 263(3):575-82.
Kleiter I, Gahlen, A, Borisow N, Fischer K, Wernecke K-D, Wegner B, Hellwig K, Pache F, Ruprech K, Havla J, Krumbholz M, Kümpfel T, Aktas O, Hartung H-P, Ringelstein M, Geis C, Kleinschnitz C, Berthele A, Hemmer B, Angstwurm K, Stellmann J-P, Schuster S, Stangel M, Lauda F, Tumani H, Mayer C, Zeltner L, Ziemann U, Linker R, Schwab M, Marziniak M, Then Bergh F, Hofstadt van Oy U, Neuhaus O, Winkelmann A, Marouf W, Faiss J, Wildemann B, Paul F, Jarius S, Trebst C, Neuromyelitis Optica Study Group (2016). Neuromyelitis optica: evaluation of 871 attacks and 1153 treatment courses. Ann Neurol 79(2):206-16.
Trebst C, Jarius S, Berthele A, Paul F, Schippling S, Wildemann B, Borisow N, Kleiter I, Aktas O, Kümpfel T; Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS) (2014). Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of theNeuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). J Neurol. 2014 Jan;261(1):1-16.
